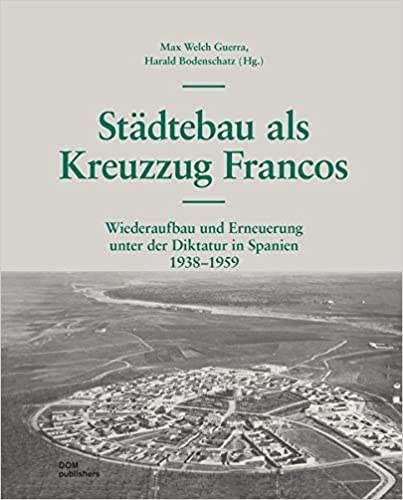Lebensweg, Leistungen und Laster eines lupenreinen Demokraten
Rezension von Knud Böhle
1. Erster Überblick
1.1 Eine wissenschaftlich fundierte biografische Studie
Der Historiker Walther L. Bernecker, der sich seit rund 50 Jahren mit der neueren Geschichte Spaniens von A wie Anarchismus (Bernecker 1977) bis V wie Vergangenheitsaufarbeitung (zuletzt Bernecker 2023) eingehend beschäftigt, hat nun Ende 2024 die erste deutschsprachige Biografie des spanischen Königs Juan Carlos I de Borbón vorgelegt.1 Die detailreiche Darstellung wendet sich an einen »größeren deutschsprachigen Leserkreis« (S. 9). Die einen mögen den König vielleicht wegen seiner Leistungen im Transformationsprozess von der franquistischen Diktatur zur Demokratie, der so genannten Transición – grob gerechnet Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre – in Erinnerung haben, andere bei seinem Namen eher an seine Korruptions- und Liebesaffären denken, die etwa ab 2008 nach und nach ans Licht kamen.2
Die vorliegende Biografie betrachtet den ganzen bisherigen Lebensweg und verknüpft ihn mit der Zeitgeschichte. In dieser wissenschaftlich fundierten, biografischen Studie (S. 8) ist es Bernecker wichtig, die Bedeutung einzelner Persönlichkeiten im historischen Prozess exemplarisch auszuleuchten ‒ hier konkret bezogen auf Juan Carlos. Das schließt ein, sich in den König hineinzuversetzen und sein Verhalten aus seiner Sicht und im Licht der Zeitumstände verstehen zu wollen. Insbesondere die Passagen, »die auf das persönliche (Fehl-)Verhalten eingehen, kommen ohne einen empathischen Zugang nicht aus« (S. 9).
Verzahnt wird in der Studie also die spanische Geschichte des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts mit dem Schicksal der bourbonischen Dynastie. Über die Person des Königs Juan Carlos I ist die entscheidende Phase der Demokratisierung Spaniens nach Francos Tod mit dem strategischen Ziel der bourbonischen Dynastie, in der Nach-Franco-Ära eine wichtige politische Rolle zu spielen, verschränkt.
1.2. Eine politische Biografie
Als politische Biografie (S. 8) ist die Studie in zweierlei Hinsichten besonders aufschlussreich: Erstens wird die unwahrscheinliche Geschichte der 1930 abgeschafften Bourbonen-Dynastie erhellt, der es durch die Umstände möglich gemacht wurde und gelang, sich in die demokratische Verfassung von 1978 einzuschreiben und damit im Gefüge der politischen Institutionen erneut zu etablieren. Folgt man dem Buch, ist es schwer vorstellbar, dass diese »mission impossible« ohne die Persönlichkeit und die Tatkraft des Königs Juan Carlos I, der nach dem Tode Francos alles auf die Karte der Demokratie setzte, hätte erfolgreich sein können.
Zweitens wird der Absturz des Königs, seine Skandale, seine Abdankung, sein Rückzug aus der Öffentlichkeit, schließlich sein freiwilliges Exil ausführlich beleuchtet. Der aktuelle Aufenthaltsort des mittlerweile 86-jährigen Juan Carlos ist bezeichnenderweise kein Kloster, sondern Abu Dhabi, wo er in einer Art freiwilligem Luxusexil lebt.
Neben psychologischen Aspekten, die sein (Fehl)Verhalten verständlich machen sollen, wird auch die soziologisch institutionelle Seite befragt: Hätte das Fehlverhalten des Königs womöglich verhindert werden können? Bemerkenswert in dem Zusammenhang sind das lange Beschweigen der Skandale von Seiten der Medien sowie die mangelhaften familiären und politischen Kontrollmechanismen. Bemerkenswert ist gleichzeitig aber auch das unablässige Bemühen staatlicher Stellen – von der Exekutive über die Legislative bis zu den Geheimdiensten –, das Ansehen des Königs als Person und Institution in der Öffentlichkeit nicht beschädigen zu lassen. Bis heute ist Juan Carlos, der auch nach seiner Emeritierung 2014 noch als König angesprochen werden darf, nicht rechtskräftig verurteilt.
Im Folgenden soll auf Basis des vorliegenden Buches ‒ einführend oder zur Erinnerung ‒ der Lebensweg von Juan Carlos, gerafft und zugespitzt auf politisch relevante Aspekte, kurz dargestellt werden.
An manchen Stellen, und dann auch im Schlussabsatz, wird auf der Grundlage des von Bernecker ausgebreiteten Materials aufgezeigt, dass in der Beurteilung des Königs als Person und politischer Figur durchaus kritischere Akzente, als sie der Autor selbst setzt, gerechtfertigt sind. Leserinnen und Leser der Biografie werden sehen, welches Bild des Monarchen in ihnen im Lauf der Lektüre entsteht.
2. Juan Carlos 1938 bis 1974
Juan Carlos, Sohn des Juan de Borbón y Battenberg (20. Juni 1913 – 1. April 1993) und Enkel des früheren Königs Alfonso XIII (17. Mai 1886 – 28. Februar 1941), wurde am 5. Januar 1938 in Rom geboren. Unter dem Druck der internationalen politischen Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Diktator Francisco Franco in einem Gesetz über die Nachfolge in der Staatsführung vom Juli 1948 verfügt, dass Spanien in Übereinstimmung mit seiner Tradition als Königreich verfasst ist (Art. 1) und der Staatschef den Cortes jederzeit die Person vorschlagen kann, von der er meint, dass sie eines Tages zu seiner Nachfolge berufen werden sollte (Art. 6).3
Im selben Jahr, Juan Carlos ist gerade mal zehn Jahre alt, vereinbaren sein Vater, meistens als Don Juan angesprochen, und der Diktator, den Jungen in Spanien ausbilden zu lassen. Für die Dynastie der Bourbonen erhöht sich damit die Chance, in der Zukunft politisch in Spanien wieder eine Rolle zu spielen. Im November 1948 kommt Juan Carlos in Spanien an und seine schulische und militärische Erziehung beginnt.
Zwei persönliche, beziehungsweise familiäre Ereignisse aus der Zeit der Ausbildung, ein tragisches und ein erfreuliches, seien kurz genannt. Juan Carlos ist 18 Jahre alt, als es zu einem tödlichen Unfall kommt, bei dem ein Schuss aus seiner Pistole dem jüngeren Bruder Alfonso das Leben kostet. Der Hergang ist letztlich ungeklärt und wurde nicht weiter untersucht: Der Vater der beiden Jungen, Don Juan, vermied selbstherrlich eine Untersuchung, veranlasste keine Obduktion und entsorgte die Schusswaffe im Meer.
Das freudige Ereignis ist die Heirat mit der Prinzessin Sofia von Griechenland im Jahr 1962. Bekanntlich entstammen dieser Ehe drei Kinder, zwei Mädchen, Elena und Cristina, und ein Junge, Felipe, der am 30. Januar 1968 geboren wurde. Manche wollen wissen, dass Juan Carlos sich danach einer Vasektomie unterzog (S. 188), was etwa im Zusammenhang mit Vaterschaftsklagen, die es später durchaus gab, relevant sein konnte.
Politisch ist von Interesse, wie Bernecker ausführt, dass Juan Carlos bereits zu Beginn der 1960er Jahre immer wieder seiner Überzeugung Ausdruck verliehen haben soll – selbstverständlich nicht öffentlich –, »dass er keiner franquistischen Monarchie vorstehen wolle, da diese in einem demokratischen West-Europa keine Zukunft habe« (S. 39). In der althergebrachten Formel der bourbonischen Monarchen, König aller Spanier sein zu wollen, die Juan Carlos später gerne verwendete, drückt sich vernehmbar die Ablehnung des Franco-Regimes aus, das auf der Unterscheidung von Siegern und Besiegten im Bürgerkrieg (1936-1939) beruhte und den Alltag der Spanier unter der Diktatur prägte.
Im Juli 1969 ernannte Franco Juan Carlos zu seinem Nachfolger und verlieh ihm den Titel Prinz von Spanien. Nach seinem Tod sollte Juan Carlos als König das Amt des Staatsoberhaupts einnehmen und die Diktatur fortsetzen. Entsprechend musste der Prinz auf die franquistischen Gesetze und die Grundsätze der Nationalen Bewegung schwören. »Für Juan Carlos«, so Bernecker, »müssen die Jahre im ‚Wartestand‘ zwischen 1969 und 1975 ganz besonders schwierig gewesen sein« (S. 64). Diese Einschätzung bezieht sich zum einen auf den innerdynastischen Konflikt, da sein Vater Don Juan bis 1977 nicht auf seine Anrechte als König verzichtete und zum anderen darauf, als Vertreter der Diktatur auftreten zu müssen, die er letztlich überwinden wollte. Dazu mögen Loyalitätskonflikte ihn belastet haben: gegenüber Franco, hohen Militärs und einzelnen Persönlichkeiten des Franquismus, die Juan Carlos während seiner Lehrjahre kennen und schätzen gelernt hatte.
3. Juan Carlos in der Transición
3.1 Der paktierte Wechsel des politischen Systems
Aus den 60er-Jahren stammt in Grundzügen die Strategie, mit der es gelingen sollte, das alte System nach Francos Tod auszuhebeln. Der rechtliche Rahmen der Diktatur bestand aus einem Ensemble an Verfassungsgesetzen, die geändert oder durch zusätzliche Gesetze erweitert werden konnten. Im Rahmen der franquistischen Legalität, so die Grundidee, sollte ein politisches Reformgesetz als Verfassungsgesetz durchgesetzt werden, welches frühere Gesetze überschrieb und außer Kraft setzte und letztlich eine neue, demokratische Legalität ermöglichen würde. Torcuato Fernández-Miranda, einer der entscheidenden Lehrer und Vertrauten von Juan Carlos, wird als der Stratege angesehen, der diesen Reformansatz ersonnen hat, den er selbst auf die Formel brachte: »de la ley a la ley, a través de la ley« (im Sinn wie oben beschrieben: vom Gesetz zum Gesetz durch das Gesetz).
Die Staatskunst würde natürlich darin bestehen, zum einen die Cortes, das franquistische Pseudoparlament, dazu zu bringen, sich selbst abzuschaffen und zum anderen große Teile der anti-franquistischen linken Opposition für dieses Vorgehen zu gewinnen. Das gelang und wurde dann als »paktierter Umbruch« (ruptura pactada) bezeichnet. Relevante Reformkräfte im franquistischen System setzten entschieden auf die Karte der Demokratie, aber sie wollten keinen radikalen Bruch und nicht Verlierer des Wandels werden. Das kommt sehr deutlich auch in einer späteren Äußerung des Königs zum Ausdruck: »Ich wollte auf keinen Fall, dass die Sieger des Bürgerkriegs die Besiegten der Demokratie würden« (S. 174). In der Konsequenz bedeutete das freilich auch das Weiterwirken franquistischer Amtsträger und Strukturen im demokratischen Rahmen.
In der politisch und historisch wichtigen Phase, den Jahren der Transformation des Franco-Regimes in eine parlamentarische Demokratie, sehen wir Juan Carlos als treibende Kraft im Reformprozess im Zusammenspiel mit der Regierung Adolfo Suárez und dem Parlamentspräsidenten Torcuato Fernandez-Miranda sowie den anti-franquistischen Oppositionsparteien. Der Druck der Straße (Demonstrationen, Protestbewegungen, Streiks) wirkte sich zudem positiv auf das Tempo der Veränderungen aus. Der politische Reformprozess insgesamt und die Verfassungsgebung insbesondere mussten aber so behutsam voranschreiten, so die Einschätzung der meisten Reformkräfte, dass die franquistischen Militärs und andere uneinsichtige Anhänger des Franco-Regimes den Reformprozess nicht zunichte machten.
3.2 Der janusköpfige König
Damit das gelingen konnte, war die Figur des, wenn man so will, janusköpfigen Königs entscheidend, der den Militärs Kontinuität und den Reformkräften demokratischen Aufbruch signalisierte. Auf die Persönlichkeit und die Position des Königs kam es entscheidend an. In der Figuration der Transformation fungierte er als Mittler zwischen alter und neuer Legalität. Beides zusammen, Persönlichkeit und Position als Königsfigur, machen ihn aus Sicht des Rezensenten zur historischen Figur. Bei Bernecker macht es den Eindruck, als betone er vor allem die Bedeutung der Persönlichkeit und weniger die der Königsfigur.
Im Reformprozess nach Francos Tod, eine Monarchie als künftige Staatsform zu fordern, entsprach den Interessen der Dynastie und den alt-franquistischen Kräften, die im Erhalt der Monarchie eine Verteidigungslinie sahen, die nicht aufgegeben werden durfte. Von Seiten der anti-franquistischen demokratischen Opposition war die Akzeptanz der Monarchie als Staatsform ein pragmatisches Zugeständnis: Der Reformprozess sollte nicht an dieser Frage scheitern. Anders gewendet: Die Drohung der Militärs im Hintergrund, den Reformprozess gegebenenfalls zu torpedieren, wirkte sich auf die Verfassung aus ‒ zugunsten der Staatsform Monarchie und der dynastischen Interessen der Bourbonen.
Es gibt zwei Ausnahme-Situationen, in denen die ambivalente Figur des Königs und seine Persönlichkeit für den Gang der Demokratisierung entscheidend waren. In beiden Situationen kam es auf den Einfluss des Königs auf die reaktionären Militärs an. Erstens, was oft vergessen wird, darauf weist Bernecker nachdrücklich hin, wurde mit der Legalisierung der kommunistischen Partei Ostern 1977 offenbar eine rote Linie für die reaktionären Militärs überschritten (S. 94). »In jenen Wochen war Juan Carlos rund um die Uhr damit beschäftigt, die Militärs zu beschwichtigen«. Und dadurch hat er sich zweifellos »in jener kritischen Phase der Transition um den Demokratisierungsprozess verdient gemacht« (S. 95).
Eine zweite Ausnahme-Situation, in der die ambivalente Figur des Königs und die Person Juan Carlos für den Gang der Demokratisierung entscheidend waren, wird in Spanien kurz als 23-F angesprochen. 1981 hatte als Krisenjahr begonnen: Wirtschaftskrise, zahlreiche Terroropfer (nicht nur der ETA) sowie eine Regierungskrise, die im Januar zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Adolfo Suárez geführt hatte. Am 23. Februar 1981 (23-F) unternahmen in der Krise dann Angehörige der paramilitärischen Polizeitruppe Guardia Civil unter Oberstleutnant Antonio Tejero sowie die Generäle Milans del Bosch und General Alfonso Armada (ein langjähriger Vertrauter des Königs) einen Staatsstreichversuch, der nicht zuletzt durch das entschiedene Auftreten des Königs vor und abseits der Fernsehkamera zu einem Ende kam.
In der Diskussion, was der König selbst mit dem Putsch zu tun hatte und was er von dem Putsch wusste, formuliert Bernecker vorsichtig: der König hat und hätte keiner Initiative zugestimmt, die einen Verfassungsbruch impliziert hätte (S. 127). Nach Auffassung des Rezensenten ließe sich sogar noch stärker akzentuieren, dass der König überhaupt kein Interesse haben konnte, die demokratische Verfassung, der er seine Position und die Institutionalisierung der Monarchie im politischen System verdankte, durch den Rückfall in eine Militärdiktatur oder eine Regierung der Konzentration mit militärischer Führung, aufs Spiel zu setzen. Eine solche Lösung wäre im damaligen Demokratisierungsprozess und internationalem Kontext wohl nur sehr kurzlebig gewesen. Auf die Karte der Demokratie und der Verfassung zu setzen, ohne wenn und aber, lag so gesehen im unmittelbaren Eigeninteresse des Königs, seiner Dynastie und der parlamentarischen Monarchie.
3.3 Zur Legitimationsfrage
In der Verfassung heißt es zur Monarchie: Die Krone Spaniens ist erblich in der Linie der Nachfolger S. M. Don Juan Carlos I von Borbón des legitimen Erben der historischen Dynastie (zit. nach Bernecker S. 81).4 In dem oben bereits angesprochenen Kontext der Drohung der Militärs, blieb den Verfassungsvätern »auch nicht viel anderes übrig als die Monarchie als Staatsform anzuerkennen« (S. 83). 1978 nahm die spanische Bevölkerung mit 88-prozentiger Mehrheit die Verfassung an. Diese Zustimmung »wurde dann jedoch zugleich als Zustimmung zur parlamentarischen Monarchie und als deren demokratische Legitimation gedeutet« (S. 83).5
Die Legitimation der Monarchie im Rahmen der neuen demokratischen Ordnung konnte sich, das analysiert Bernecker sehr genau, weder umstandslos auf die konstitutionelle Monarchie gründen, die mit und wegen Alfonso XIII gescheitert war, und mit der II. Republik (1931-1939) geendet hatte. Sie konnte sich aber auch nicht auf die von Franco ersonnene und damit kontaminierte Königsdiktatur gründen. Bernecker spricht bezogen auf den eingeschlagenen Weg von demokratisch-charismatischer Legitimation, die der Monarch durch seine aktive politische Rolle im Demokratisierungsprozess unter Beweis zu stellen hatte (S. 82). Das Charisma spielte vor allem in Zeiten des Übergangs in der Tat eine entscheidende Rolle, als die Militärs und andere autoritäre, antidemokratische Kräfte beschwichtigt werden mussten, und gleichzeitig der antifranquistischen Opposition die Ernsthaftigkeit des angestrebten Systemwandels überzeugend vermittelt werden musste, um sie für die »ruptura pactada« zu gewinnen.
War die Demokratie einmal gefestigt und die Monarchie in der Verfassung als Staatsform parlamentarische Monarchie und der König als Staatsoberhaupt verankert, reduzierte sich gleichzeitig die Macht des Königs: es blieben ihm im Wesentlichen repräsentative Aufgaben. An die Stelle des Charismas traten damit Vorbildlichkeit, Mustergültigkeit und Nützlichkeit als entscheidende Tugenden. Aus Sicht der Dynastie dürfte der Machtverlust dadurch aufgewogen worden sein, dass Spanien weiterhin eine bourbonische Erb-Monarchie war, die fortan das Staatsoberhaupt stellen würde.
Viele Beobachter betrachten die Phase der Transformation 1982 für abgeschlossen, als die PSOE (Partido Socialista Obrero Español), eine Partei eindeutig nicht-franquistischer Provenienz, in den Wahlen die absolute Mehrheit gewann. Der König konnte sich danach in seiner Rolle als Repräsentant Spaniens und als Motor guter Beziehungen zu der arabischen Welt und Lateinamerika hervortun. Die Auftritte des Königs waren »– vor allem in Iberoamerika und im arabischen Raum – bei der Anbahnung großer Geschäfte ausgesprochen hilfreich. Regionalen Usancen entsprechend flossen dabei auch nicht unerhebliche ‚Vermittlungsgelder‘« (S. 146). Seine Rolle als Wirtschaftsemissär »kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden« (S. 141).
Die Phase in der Juan Carlos I für die Demokratisierung stand und außenpolitisch und außenwirtschaftspolitisch sichtbar die Interessen Spaniens vertrat, dürfte mindestens bis zu den Krisenjahren ab 2008 reichen. Der bekannte britische Historiker Paul Preston (2003) titelte in seiner Biografie, die damals hohen Sympathiewerte des Königs reflektierend »El Rey de un pueblo«, was sich etwa als König eines Volkes, König aller Spanier, als Volkskönig oder als beim Volke beliebter König verstehen lässt.
4. Vom Sympathieverlust in Spanien zum Umzug nach Abu Dhabi
Mit den multiplen Krisen des Landes ab 2008 ändert sich auch der Blick auf den König und sein Verhalten. Die überarbeitete und ergänzte Fassung von Prestons Biografie des Königs (Preston 2023) behält zwar noch denselben Titel »El Rey de un pueblo«, endet aber mit dem trockenen Fazit angesichts der verlorenen Faszinationskraft des Königs: »es poco probable que se le vuelva a llamar ‚El Rey de un pueblo‘« Sinngemäß übersetzt heißt das: Es ist nicht gerade wahrscheinlich, dass man ihn jemals wieder
»Volkskönig« nennen wird (Preston 2023, S. 714).6
In der Biografie Berneckers wird das ganze Ausmaß an (mutmaßlicher) Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Amtsmissbrauch und außerehelichen Beziehungen ausführlich dargestellt. In der Summe führen die Faken und Vorwürfe im Juni 2014 zur Abdankung des Königs, im Mai 2019 zum Rückzug aus allen Ämtern und Pflichten und im August 2020 zum Umzug nach Abu Dhabi, »um – wie es in einem später veröffentlichten Brief hieß – die Arbeit Felipes vor dem Hintergrund der Vorwürfe zu ‚erleichtern‘« (S. 226).
Hier sollen nur wenige, aber signifikante Beispiele aus einer Fülle von problematisch bis kriminell zu nennenden Handlungen hervorgehoben werden. Bereits in der Phase der Transición, 1981, werden dem König vom saudischen Königshaus eine Million Dollar bereitgestellt, die angeblich zur finanziellen Absicherung von Adolfo Suárez nach dessen Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten bestimmt waren. Zugleich sollte die Summe ihn von weiteren politischen Aktivitäten abhalten. (S. 192). Hier kommen die Einmischung eines ausländischen Staates in die inneren Angelegenheiten Spaniens und zumindest der Versuch der Bestechung eines Politikers zusammen. Übrigens fielen andere Zuwendungen zu anderen Zwecken aus arabischen Staaten noch weit höher aus.
Anders gelagert ist der vom spanischen Staat finanzierte Umbau des Anwesens La Angorrilla, wo Juan Carlos mit Corinna Larsen »jahrelang ein familienähnliches Zusammenleben zelebrierte« (S. 188f.) – keine 20 km vom Königspalast entfernt. Es wundert da nicht, dass die Königin Sofia über ihren Mann einmal sagte »Er wird sterben ohne zu wissen, was Schamgefühl ist« (S. 166).
In der Affäre des Königs mit der Sängerin und Schauspielerin Bárbara Rey, die den Monarchen erpresst haben soll, war es erneut die Staatskasse, aus der über mehrere Jahre Schweigegeld von insgesamt mehr als drei Millionen Euro gezahlt wurde (S. 190). Das private Vermögen, das der König über die Jahre angehäuft hatte und sich laut New York Times (2012) auf ca. 1,8 Mrd. US-Dollar belief, brauchte nicht einmal für diese Ausgaben angetastet zu werden (S. 194).
Der Staat zahlte nicht nur, er schützte den König auch vor gerichtlichen Prozessen. Das ist abzulesen an einem unscheinbaren Gesetz von 2014, das einen Tag nach der Abdankung des Königs in Kraft trat und die in der Verfassung enthaltene Immunität des Königs nun in einem weiten Verständnis ausdeutet: alle Handlungen des Königs während seiner Amtszeit als Staatsoberhaupt, unabhängig von ihrer Art, wurden in die Straffreiheit einbezogen und waren damit rechtlich nicht einzuklagen (Ley Orgánica 4/2014, 11. Juli 2014).7
Wie konnte es soweit kommen? Ein Erklärungsstrang bringt etwa falsche Freunde, zu enge Kontakte mit korrupten Wirtschaftseliten und die Selbstwahrnehmung des Königs ins Spiel, der seine erste Lebenshälfte als Aufopferung für die Monarchie verstanden zu haben scheint. Sogar ein auf seine Kindheit zurückgehendes »tiefgreifendes Armutstrauma« (S. 243) wird für sein Fehlverhalten mit verantwortlich gemacht.
Der andere Erklärungsstrang setzt beim Fehlen funktionierender Kontrollmechanismen an. Es gab keine innerfamiliären Kontrollmechanismen. Die Massenmedien machten das Fehlverhalten des Königs nicht publik, selbst wenn sie davon wussten (»ungeschriebener Verschwiegenheitspakt«) (S. 245f.). Sie erlagen, wie auch die Regierungschefs, so Bernecker, »dem sprichwörtlichen Charme des Monarchen – einem Charme, der ihm schließlich zum Verhängnis wurde, da er zu gesellschaftlicher Kritiklosigkeit führte, die wiederum den König seine Vorbildfunktion in einer parlamentarischen Monarchie einbüßen ließ« (S. 246).
Anders gelesen wurde der König vielleicht nicht Opfer seines Charmes, sondern seines undemokratischen Kerns. Delikte wie Steuerhinterziehung, Steuerflucht in Steueroasen, Geldwäsche, Schmiergelder, Schweigegelder aus der Staatskasse sind anti-demokratisch und stehen in direktem Widerspruch zu Gesetzestreue und Vorbildlichkeit, die ein Bürger von seinem Staatsoberhaupt erwarten darf.
Für ein Staatsoberhaupt, dem so viel daran lag, positiv in die Geschichtsbücher einzugehen (S. 192) und das nicht müde wurde, die Tugenden der Demokratie und die Verantwortung der Amts- und Würdenträger jahrein, jahraus zu predigen, und sich dennoch über die Gesetze des demokratischen Gemeinwesens stellte, ist die Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit frappierend.
Sein Fehlverhalten mag durch allerlei Entschuldigungsversuche relativiert werden, lässt aber den Schluss zu, dass der König trotz aller Verdienste in der Transición von seiner Persönlichkeit her kein »lupenreiner Demokrat« ist. Eher sehen wir mit der Lupe Muster des alten Bourbonen Alfonso XIII, der »sich immer wilderen Frauenabenteuern und korrupten Geldgeschäften« hingab (S. 17).
5 Schluss
Das Verhalten des Königs auch aus einer Innensicht zu verstehen, war Bernecker wichtig: »Direkte Zitate des Königs oder von Personen aus seiner näheren Umgebung« sollten helfen, diese Sicht zu vermitteln. Ohne Frage machen die entsprechenden Passagen den Text lebendiger und atmosphärisch dichter. Das eklatante Fehlverhalten des Monarchen wird dadurch freilich nicht entschuldigt, aber das Urteil über den König wird durch die gegebenen Erklärungen abgemildert.
Eine politische Biografie sollte vielleicht noch stärker herausarbeiten, dass menschliches Fehlverhalten eine Sache ist und politische Verantwortung eine andere. Zu kurz kommt in der vorliegenden Biografie das demokratische Defizit der Person, das die Missachtung der politischen Verantwortung begünstigt. Nach der Einrichtung der parlamentarischen Monarchie in der Verfassung von 1978 sind es die demokratischen Tugenden eines hauptsächlich repräsentativ agierenden Staatsoberhaupts, die zählen. Genau diesen Tugenden, die man auf den Nenner strikter Gesetzestreue bringen kann, handelt der König zuwider.
Während Bernecker sein Buch mit der Annahme schließt, »dass letztlich das Bild des ausgleichenden und beliebten Königs obsiegen wird, der mit Geschick und Weitsicht einen wichtigen Beitrag zur Wiederherstellung der Demokratie in Spanien geleistet hat« (S. 248), würde der Rezensent eher annehmen, dass er auf Dauer von den Historikern als höchst ambivalente historische Figur wahrgenommen werden wird.
Position und Persönlichkeit erlaubten ihm im Übergang, als Mittler zwischen Franquisten, insbesondere den reaktionären Militärs, und den demokratischen Kräften zu fungieren. Der Druck und die Drohungen der reaktionären franquistischen Kreise bilden den Kontext, in dem die Monarchie in die Verfassung gelangen konnte. Der Einsatz des Königs für die demokratische Staatsform entsprach gleichzeitig dem Eigeninteresse der Bourbonen-Dynastie, im künftigen politischen System eine Rolle zu spielen. Nach Erreichen dieses Ziels scheint dem Staatsoberhaupt zunehmend weniger an den demokratischen Werten gelegen zu haben, die er vorbildhaft hätte leben sollen. Seine persönlichen Interessen wurden ihm wichtiger als die Demokratie und die Sorgen der Spanier. Nach seinem verdienstvollen persönlichen und politischen Engagement bei der Demontage des Franquismus, setzte mit Verzögerung in den Nullerjahren eine Entzauberung des vormals beliebten Königs ein, dem seine nicht mehr aufzuhaltende Demontage folgte.8
Anmerkungen
- Zahlreiche Buchpublikationen von Walther L. Bernecker lassen sich im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek finden. Die genannten Titel sind: Die soziale Revolution im spanischen Bürgerkrieg. Vögel: München 1977; ISBN: 978-3-920896-43-4 sowie Geschichte und Erinnerungskultur. Spaniens anhaltender Deutungskampf um Vergangenheit und Gegenwart. Verlag Graswurzelrevolution: Nettersheim 2023; ISBN: 3939045519. ↩︎
- Damit beschäftigt sich nebenbei bemerkt auch eine sehenswerte Dokumentation für den NDR von Anne von Petersdorff und Georg Tschurtschenthaler (Regie): Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat. Deutschland 2023 (180 Minuten). Englischer Titel: JUAN CARLOS – DOWNFALL OF THE KING. Autoren: Christian Beetz, Pedro Barbadillo, Anne von Petersdorff. Produktion: gebrueder beetz filmproduktion. Vertrieb: NBCUniversal Global Distribution. Die Dokumentation war bis vor Kurzem abrufbar in der ARD-Mediathek; derzeit wird sie zum Beispiel noch von Sky angeboten [zuletzt überprüft am 25.01.2025]. ↩︎
- Die seit 1938 erlassenen franquistischen Verfassungsgesetze gibt es in deutscher Übersetzung auch online [zuletzt überprüft am 25.01.2025]. ↩︎
- Die Verfassung des Königreichs Spanien vom 29. Dezember 1978 gibt es in deutscher Übersetzung auch online [zuletzt überprüft am 25.01.2025]. Zur Diskussion der Verfassung siehe statt anderer Aschmann, Birgit; Waldhoff, Christian (Hrsg.): Die Spanische Verfassung von 1978: Entstehung, Praxis, Krise? (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft Bd. 44). Aschendorff Verlag: Münster: 2020, ISBN: 978-3-402-14872-3 sowie Hermann-Josef Blanke, Siegfried Magiera, Johann-Christian Pielow, Albrecht Weber (Hrsg.): Verfassungsentwicklungen im Vergleich. Italien 1947 – Deutschland 1949 – Spanien 1978. Schriften zum Europäischen Recht (EUR), Band 200, Duncker & Humblot: Berlin 2021, ISBN 978-3-428-15929-1. ↩︎
- Dass kein Referendum über die Staatsformfrage stattfand, dessen Ausgang unsicher gewesen wäre und womöglich eine in dieser Frage gespaltene Gesellschaft offenbart hätte, wurde so umgangen. Der Verzicht auf ein Referendum dürfte der Stabilität der Institution Monarchie genutzt haben. Einmal in der Verfassung festgeschrieben, müsste schon Außergewöhnliches passieren, sollte sich an der Staatsform etwas ändern. Das liegt auch an den hohen Hürden für eine Verfassungsänderung der entsprechenden Artikel. Eine Änderung verlangte erstens, dass beide Kammern der Änderung mit 2/3-Mehrheit zustimmen würden, woraufhin zweitens das Parlament aufzulösen wäre und Neuwahlen stattfänden, nach denen dann drittens die beiden neu zusammengesetzten Kammern wiederum mit einer 2/3 Mehrheit der anhängigen Verfassungsänderung zustimmen müssten, bevor dann viertens der Änderungsvorschlag in einem Referendum eine Mehrheit finden müsste. Der Fall, dass der König abdanken würde, um Schaden von der Institution Monarchie/Staatsoberhaupt abzuwenden, war in der Verfassung nicht vorgesehen. Diese Lücke zu schließen verlangte aber keine Verfassungsänderung. Sie wurde durch ein entsprechendes Gesetz zur Abdankung (Ley Orgánica 3/2014, 18. Juni 2014) geschlossen, dem die Inthronisierung des neuen Königs folgte. Am 19. Juni 2014 dankt Juan Carlos I ab und sein Sohn wird als König Felipe VI vereidigt. Dieser ist bestrebt, sich als mustergültiges Staatsoberhaupt zu verhalten. ↩︎
- Die vollständigen bibliografischen Angaben lauten: Paul Preston: Juan Carlos. El rey de un pueblo. Plaza & Janes: Barcelona 2003; ISBN: 9788401378249 und Paul Preston: Juan Carlos. El rey de un pueblo. Tercera edición actualizada (abril 2023). Penguin Random House: Barcelona 2023; ISBN: 978-84-19399-55-7. ↩︎
- Eher kurios wirkt dem gegenüber die kolportierte Fürsorge des spanischen Geheimdienstes, der »dem König weibliche Hormone und Testosteronhemmer verabreicht haben soll, um seine Libido zu zügeln und seine Sexualität unter Kontrolle zu bekommen« (S. 191). ↩︎
- Sebastian Schoepp spielt in seiner Besprechung von Berneckers Buch in der Süddeutschen Zeitung vom 18. November 2024 mit dem Begriffsduo »Held der Demontage« und »Held der Selbstdemontage«. Held der Demontage, angelehnt an Überlegungen von Hans Magnus Enzensberger, war der König bezogen auf das franquistische System, das er an entscheidender Stelle zu demontieren half. »Held der Selbstdemontage«, so der bitter-ironische Titel der Rezension, wurde er dann später in eigener Verantwortung. Der eigentliche (tragische) Held der Demontage des Franquismus war für Enzensberger Adolfo Suárez. »Es ist das typische Los des historischen Abbruchunternehmers, dass er mit seiner Arbeit immer auch die eigene Position unterminiert«. Ganz anders erging es Juan Carlos I, den sein Beitrag zur Demontage des Franquismus zum beliebten König werden ließ. Seine Selbstdemontage begann damit, dass seine persönlichen Interessen grundlegende Anforderungen an ein demokratisches Staatsoberhaupt missachteten. Darauf folgte die tatsächliche Demontage, obgleich mit einiger zeitlicher Verzögerung. Die Europeana bietet den Artikel von Hans Magnus Enzensberger: Die Helden des Rückzugs (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9.12.1989) dankenswerterweise als elektronisches Faksimile [zuletzt überprüft am 25.01.2025]. ↩︎
Walther L. Bernecker: Juan Carlos I., König von Spanien. Ein biographisches
Porträt. edition tranvía – Verlag Walter Frey: Berlin 2024; ISBN: 978-3-946327-42-4