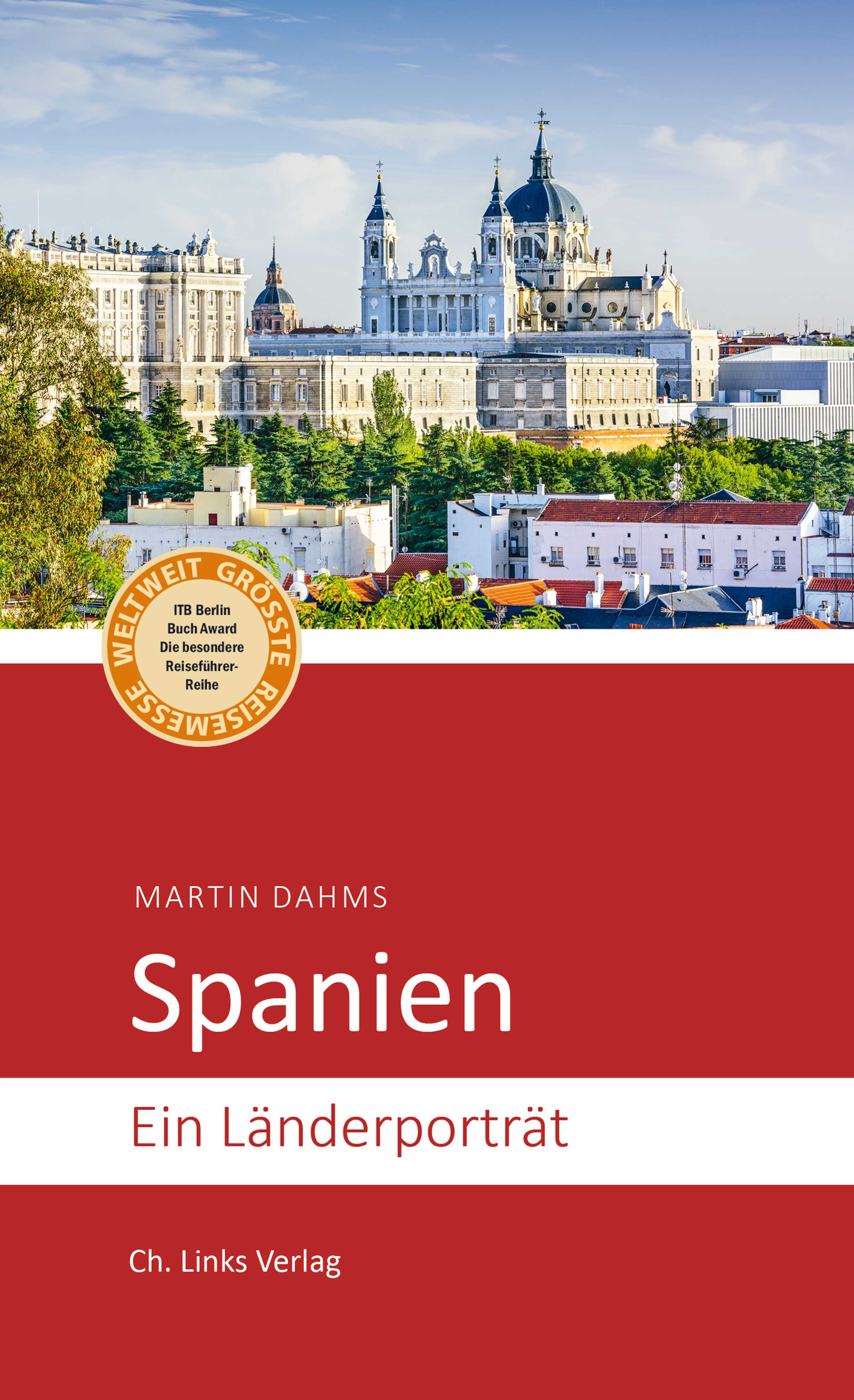Die Auswanderung nach Andalusien, ein weitgehend vergessenes Kapitel spanisch-deutscher Geschichte, wird erstmals systematisch ausgeleuchtet
Rezension von Knud Böhle
1. Aufgeklärter Absolutismus und das spanische Kolonisierungsprojekt (1767-1835)
1767 – es ist die Zeit des aufgeklärten Absolutismus in Europa: Joseph II steht seit März 1764 an der Spitze des Heiligen Römischen Reiches, Friedrich der Große herrscht über Preußen, Katharina die Große über Russland und in Spanien ist der Bourbonenkönig Karl III (Carlos III) an der Macht. Ideen der Aufklärung und physiokratisches Denken haben in Spanien Einzug gehalten. Aufklärer wie Campomanes, Aranda und Olavide bekleiden wichtige politische Ämter. Zur Ideenwelt, die die Reformpolitiker inspiriert, gehören staatlicher Interventionismus, die Verbesserung der Landwirtschaft, eine aktive Bevölkerungspolitik und Prestigeprojekte.
In diesem Zusammenhang ist die Ansiedlung von Ausländern in landwirtschaftlich ungenutzten Landesteilen (Kolonisierung) zu sehen, wie sie etwa von Preußen, Russland und eben auch von Spanien ab 1767 (in vergleichsweise kleinem Maßstab) praktiziert wird. Ebenfalls in das Jahr 1767 fällt das Verbot des Jesuitenordens und die Ausweisung der Jesuiten. Die Institution der Inquisition bleibt hingegen bestehen. Eine andere spanische Besonderheit ist das Banditentum (bandolerismo), welches den Transport überseeischer Waren von den Häfen Andalusiens nach Madrid gefährdet. Von daher ist es auch ein Ziel des Siedlungsprojekts gewesen, diese Wege (Teilstrecken des Camino Real) sicherer zu machen. In der Handschrift von Saragossa, dem weltberühmten, erstmals 1804 veröffentlichten Buch des Grafen Potocki, wird auf diesen Zusammenhang gleich zu Anfang angespielt: «Der Graf von Olavidez hatte in der Sierra Morena noch keine Ausländer angesiedelt: diese steile und stolze Gebirgskette, die Andalusien von der Mancha trennt, war also nur von Schmugglern bewohnt, von Räubern und von einigen Zigeunern…» (Inselausgabe 1980, S. 11).
Vorschläge für die Besiedlung dieser Gegend mit ausländischen Einwanderern gibt es schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts, entscheidend ist aber der April des Jahres 1767 als der König von Spanien mit dem Bayern Johann Kaspar Thürriegel einen Vertrag abschließt über 6.000 Kolonisten, die anzuwerben und nach Spanien zu bringen sind. In dem Vertrag sind genaue Vorgaben zu Herkunft, Religionszugehörigkeit, Altersstruktur und den nachzuweisenden Qualifikationen der angeforderten Kolonisten enthalten. Im Juli 1767 werden die Regularien, die in den Siedlungsgebieten gelten sollen im Fuero de Población (etwa: Sonderrechte für die Ansiedlungen) festgeschrieben. Der bereits genannte Pablo de Olavide übernimmt im Juni 1767 als Superintendente die Leitung des Kolonisierungsprojekts. Im August 1767 kommen bereits die ersten Migranten aus dem Südwesten des Heiligen Römischen Reiches in Spanien an. Die avisierten Siedlungsgebiete liegen zunächst in der Sierra Morena und ab 1768 kommen Flächen etwas weiter westlich in Andalusien dazu.

Offiziell wird bei dem Projekt seit 1768 von den Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía (etwa: Neusiedelungen in der Sierra Morena und Andalusien) gesprochen. Viele der damals neu gegründeten Dörfer gibt es noch heute. La Carolina in der Sierra Morena (Provinz Jaén), La Carlota (Provinz Córdoba) und La Luisiana (Provinz Sevilla) dürften zu den bekannteren Orten zählen. Mit der Aufhebung der letzten Sonderregelungen und staatlichen Zuwendungen für die Gebiete im Jahr 1835 endet das Projekt. Für die historische Untersuchung des Migrationsprozesses sind natürlich die ersten Jahre besonders relevant.
2. Komplexität des Themas und ihre wissenschaftliche Bewältigung
Nicola Veith bearbeitet das Thema in ihrer Dissertation (Johann-Gutenberg Universität Mainz, Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften) auf die denkbar anspruchsvollste Weise, indem sie den Migrationsprozess auf Basis der wissenschaftlichen Literatur und intensiver Archivarbeit – verbunden mit dem Studium überwiegend spanischer und deutscher Quellen und Materialien – analysiert und rekonstruiert (vgl. zur Quellenlage S. 22-28).
Erstmalig wird hier der Migrationsprozess ganzheitlich dargestellt. Das bedeutet, dass zunächst die Umstände der Emigration aus dem Heiligen Römischen Reich (deutscher Nation) und die Reiserouten und Reiseverläufe bis in das neue Siedlungsgebiet untersucht werden. Erst danach wird die Ansiedlung und die sich anschließende Geschichte der Entwicklung der Kolonien und der Integration der Auswanderer behandelt. Dem entspricht in der Gliederung der Arbeit die folgende Dreiteilung: Teil I: Hintergründe der Spanienauswanderung im 18. Jahrhundert, Teil II: Verlauf der Spanienauswanderung 1767 bis 1769 und Teil III: Ansiedlung und Integration.
Im Rahmen dieser Struktur werden erstens die rechtlichen, politischen, organisatorischen und finanziellen Aspekte detailliert behandelt. Zweitens werden sowohl die Lebensbedingungen in der Herkunftswelt, die die Auswanderer motivierten, als auch die soziale Wirklichkeit in den Ansiedlungen und die sich dort nach und nach bildende neue Alltagswelt akribisch herausgearbeitet. Für die exemplarische Untersuchung der Herkunftswelten werden insbesondere die Kurpfalz, die Markgrafschaft Baden-Durlach sowie der schwäbische Raum ausgewählt. Fast unwillkürlich denkt man, dass auch diese Auswanderungsgeschichten einen Filmemacher wie Edgar Reitz (Stichwort: Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht) verdient hätten.
Die von Nicola Veith zu bewältigende Komplexität des Themas ist hoch. Vorschnelle Vereinfachungen verbieten sich. Es geht um notwendige Differenzierungen. Lässt man sich, um gleich das wichtigste Beispiel zu nehmen, genauer auf die Herkünfte der Migranten ein, wird die Bedeutung solcher Differenzierung sichtbar: Zwar waren die überwiegende Anzahl der Kolonisten südwestdeutsche, elsässische und lothringische Bauern und Handwerker. Aber dazu kommen dann weitere Kolonisten aus den verschiedenen deutschsprachigen Gebieten des Heiligen Römischen Reiches, den Niederlanden und der Schweiz, und weitere Kolonisten mit französischer Muttersprache aus der Schweiz und Frankreich sowie Italiener (vgl. S. 354). In dem Zusammenhang vertritt Nicola Veith die interessante These, dass die deutschsprachigen Migranten zwar durch die Fremdzuschreibung als «Deutsche» in ihrer regionalen und territorialstaatlichen Identität (als Kurpfälzer, Badener etc.) geschwächt wurden, dass aber gerade die dadurch ermöglichte gemeinsame Identität als «Deutsche», die Integration in den Kolonien erleichterte (vgl. S. 361, S. 399).
Für ein realistisches Gesamtbild der Auswandererkolonien kommt es zudem darauf an, viele unterschiedliche Facetten in die Betrachtung einzubeziehen: Fragen der Siedlungsform, Architektur, Bodenbeschaffenheit, Kolonialverwaltung, Familienstrukturen, Nachbarschaftsbeziehungen, Krankenversorgung, Seelsorge, Freizeitgestaltung etc., die in dieser Rezension aber nicht weiter vertieft werden können. Dem sechsseitigen Inhaltsverzeichnis, das online als pdf-Dokument verfügbar ist, kann man die Vielzahl der in der Dissertation behandelten Aspekte entnehmen.
3. Widersprüche, Fehler und Konflikte im Kolonisierungsprojekt
Ein Verdienst der Arbeit liegt darin, wichtige im Projekt angelegte und im Projektverlauf aufgetretene Konflikte und Widersprüche herausgearbeitet zu haben, was die Grundlage für eine kritische Gesamtbewertung liefern kann. Einige kritische Punkte sollen hier kurz angesprochen werden.
Bereits die Anwerbung von Kolonisten stand im Widerspruch zu den im 18. Jahrhundert geltenden Auswanderungsverboten im Heiligen Römischen Reich (vgl. S. 72). Die Emigration war von daher widerrechtlich und fand meistens heimlich statt (S. 105). Insbesondere stand das Bestreben der Herkunftsländer, die qualifizierten Bauern und Handwerker zu halten, im Widerspruch zu dem Ziel gerade diesen Personenkreis für das prestigeträchtige Kolonisierungsprojekt zu gewinnen. In der Praxis bedeutete das, dass viele der in Spanien aufgenommenen Auswanderer die erwarteten Qualifikationen nicht mitbrachten.
Widersprüchlich war auch die Mischung aufklärerischer und despotischer Tendenzen, die die wirtschaftliche Praxis in den Kolonien kennzeichnete (vgl. S. 214-253). Auf der Seite des Fortschritts in der Landwirtschaft standen die Kombination von Ackerbau-, Viehzucht und Handwerk als Wirtschaftsgrundlage, eine Schulpflicht und für die Frauen eine aktivere Rolle im Wirtschaftsleben. Kritisch ist ein «Übermaß an staatlicher Regulierung» (S. 30) zu sehen, das etwa an der anfänglichen Verteilung gleichgroßer Grundstücke, ohne die Bodenqualität in Rechnung zu stellen, abzulesen ist, oder am Beharren auf dem Anbau von Getreide trotz dafür ungünstiger landwirtschaftlicher Gegebenheiten und der damit einhergehenden verzögerten Umstellung auf ertragreichere Pflanzungen (S. 403). Auf der Negativseite steht weiter, dass die Kolonisten in den ersten Jahren keine Möglichkeit der Mitbestimmung hatten (S. 192). Nicola Veith spricht von einer annähernd militärischen Verwaltung der Kolonien (S. 398). «Untätigkeit zählte als Straftat» (S. 404), die mit Fußfesseln bei der Arbeit oder sogar Gefängnis geahndet werden konnte. Außerdem wurde wenig Geselligkeit zugelassen, was mit der Streulage der Höfe und dem Verbot, während der Woche die zentralen Orte zu besuchen, zusammenhing. Dennoch: vor der Kontrastfolie des Latifundismus, dem in Andalusien vorherrschenden Typus ausbeuterischen und wenig effektiven Großgrundbesitzes, wird der staatlich hoch subventionierte Versuch, eine «bäuerliche Mittelschicht» (S. 406) zu etablieren, als fortschrittlich erkennbar.
Zu den gravierenden Fehlern der Projektverantwortlichen, die die Autorin der Studie im Einzelnen nachgewiesen hat, gehörte die mangelhafte Vorbereitung auf die Herausforderungen der Ansiedlung in der Anfangszeit. So kamen die ersten Siedler erst im Spätsommer und Herbst 1767 an, das Neuland war zu dem Zeitpunkt noch nicht urbar gemacht und Unterkünfte standen kaum zur Verfügung (S. 172). Selbst dort wo Unterkünfte auf den Grundstücken entstanden waren, verfügten die Projektverantwortlichen, dass die Kolonisten (wieder) in große Baracken in den Hauptkolonien ziehen sollten – anstatt auf ihren Grundstücken zu bleiben. Dadurch begünstigt brachen Epidemien aus und es „ist anzunehmen, dass bis 1770 etwa die Hälfte der Kolonisten verstarb“ (S. 405). In diese Schätzung fließen freilich auch Angestellte der Kolonien, Handwerker, die beim Hausbau halfen, Soldaten sowie spanische Kolonisten ein. Außerdem dürfte die Situation je nach Ort stark variiert haben.
Mit dem Nachzug von Spaniern aus Katalonien und Valencia, und später auch aus anderen, ärmeren Gegenden Spaniens, wurde dieser Aderlass kompensiert. Die Zahl der Spanier in den Kolonien glich sich wahrscheinlich bereits im Jahr 1771 derjenigen der Ausländer an (S. 369-372). Damit veränderte sich freilich der Charakter des Vorzeigeprojekts grundlegend.
Religionszugehörigkeit und Religionsausübung bildeten eine weiteres Konfliktfeld. Das begann damit, dass nur Katholiken angeworben werden sollten, diese Bedingung aber von dem Werber Thürriegel nach Möglichkeit verschwiegen wurde. Das führte bei der Kontrolle der Einwanderer in Spanien häufig zu Scheinkonvertierungen und in einigen Fällen auch später noch zur Ausweisung von Protestanten. Problematisch war auch die seelsorgerische Betreuung, die laut Bestimmung im Fuero de Población für die ersten Jahre in der Muttersprache erfolgen sollte (S. 258). Die Kolonialleitung hatte indes die Akquise von Priestern nicht recht bedacht und kam erst 1769 darauf, den Bedarf durch deutschsprachige Kapuzinermönche, 18 an der Zahl, wie Nicola Veith aufzeigt, zu decken. Diese Mönche kümmerten sich offenbar nicht nur um seelsorgerische Belange, sondern legten sich auch mit der Kolonialverwaltung im Interesse der deutschsprachigen Siedler an (S. 262). In dem Maße, in dem ab 1770 zunehmend auch spanische Siedler aufgenommen wurden und das deutsche Brauchtum zurückgedrängt wurde, verschärfte sich der Konflikt. Das führte sogar dazu, dass der Kapuziner Romualdo Baumann im Jahr 1774 den Leiter des Kolonisierungsprojekts, Pablo de Olavide, bei der Inquisition als Ketzer denunzierte, weil der «protestantisches Gedankengut in sich trüge und sich gegen die kirchlichen Dogmen ausspreche» (S. 270). Es kam zum Prozess und zur Verurteilung Olavides (sicherlich nicht nur wegen Pater Romualdos Anzeige). Aber auch die Kapuziner mussten danach die Kolonien und Spanien verlassen.
4. Ist das Kolonisationsprojekt gescheitert, oder war es ein Erfolg?
Fragen wir abschließend auf Basis der Dissertation nach Erfolg und Scheitern des Projekts. Die Anwerbung jedenfalls war erfolgreich und Thürriegel übererfüllte (nach eigenen Angaben) sogar sein Soll mit 7.775 Siedlern, die er abrechnen konnte (mit 326 Reales je angenommener Person, S. 151).
Unter dem Gesichtspunkt der ursprünglichen Projektidee einer allein von kompetenten Ausländern aufgebauten fortschrittlichen und mustergültigen Landwirtschaft kommt man nicht umhin, von einem Scheitern zu sprechen.
Betrachtet man jedoch die Kolonien ab 1770, an deren Entwicklung ausländische und spanische Kolonisten mitwirkten, ergibt sich ein positiveres Bild. Einer zitierten Quelle nach wächst die Bevölkerung von 6.585 Personen im Jahr 1770 auf 11.857 Personen im Jahr 1833 (S. 386, S. 389). Diese Entwicklung geht mit einem wirtschaftlich positiven Wachstum zusammen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Integration ließe sich von einer Erfolgsgeschichte sprechen, da sich die Ausländer im Lauf weniger Jahrzehnte fast vollständig in die spanische Gesellschaft integrierten. Dem entspricht auch der Befund von Nicola Veith, dass viele «Auswandererbiografien beweisen, dass der Bogen von der heimatlichen Misere zum spanischen Eigentum in zahlreichen Fällen geglückt war» (S. 406).
5. Fazit
Die Dissertation liefert einen wichtigen Beitrag zu einem vernachlässigten und fast vergessenem Kapitel deutsch-spanischer Geschichte, und zu einer ganzheitlichen und prozessorientierten historischen Migrationsforschung. Diese Studie kann auch für die Gegenwart von Nutzen sein, insofern aus ihr wertvolle Anhaltspunkte und Einsichten zu gewinnen sind für die Untersuchung heutiger Projekte zur Anwerbung qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte und die Analyse aktueller Migrationsprozesse.
Nicola Veith: Spanische Aufklärung und südwestdeutsche Migration. Auswandererkolonien des 18. Jahrhunderts in Andalusien. Kaiserslautern: Bezirksverband Pfalz, Inst. f. pfälz. Geschichte und Volkskunde 2020, ISBN: 978-3-927754-97-3